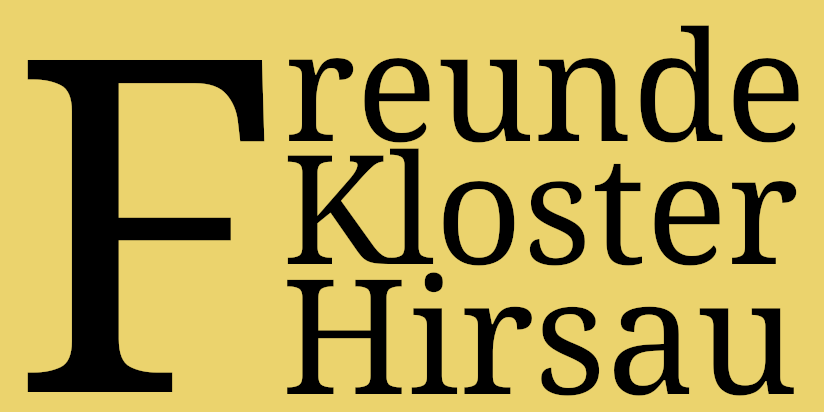Gegenständliche Erinnerungsstücke
Ambo aus der ersten Aureliuskirche
Das landesgeschichtlich wohl bedeutendste Relikt aus Hirsau sind Steinplatten mit langobardischer Flechtbandornamentik, die zu einem Ambo in der ersten Aureliuskirche aus der karolingischen Zeit um 830 gehören. Die Originale sind in der Dauerausstellung des württembergischen Landesmuseums im Alten Schloss in Stuttgart zu sehen. (1955 – 26, 27, 28)
Weitere Informationen
Lesepult aus St. Peter und Paul
Ein bedeutendes Holzbildwerk aus der Mitte des zwölften Jahrhunderts ist ein Lesepult aus der Peter-und-Pauls-Kirche, das sich heute in der Freudenstädter Stadtkirche befindet. Die württembergischen Herzöge als neue Eigentümer des Klosters nach der Reformation verwendeten dessen Inventar um damit die Kirche in ihrer neu projektierten Residenzstadt auszustatten. (Ev. Kirchengemeinde Freudenstadt)
Weitere Informationen
Kruzifix aus Dettenhausen
In ganz ähnlichem Stil wie die Evangelisten am Freudenstädter Lesepult wurde das sogenannte Kruzifix aus Dettenhausen geschaffen. Dettenhausen war im Hochmittelalter im Besitz von Kloster Hirsau, was die These des Hirsauer Ursprungs des Kruzifixes unterstützt. Heute befindet sich die Skulptur im Depot des württembergischen Landesmuseums. (WLM 1929 – 343)
Weitere Informationen
Rheinische Madonnenfigur
Eine hochmittelalterliche, rheinische Madonnenfigur aus der Zeit um 1330, die ursprünglich aus dem Kloster Hirsau stammt, wurde 2013 aus Familienbesitz der Diözese Limburg übereignet und ist jetzt in der Gregorskapelle des Limburger Domes zu sehen.
Weitere Informationen
Brunnenschalen des Peter-und-Pauls-Klosters
Der württembergischen Herzog Eberhard Ludwig ließ 1713 die zwei größten Schalen des Brunnens aus der Brunnenkapelle im Kreuzgang des Peter-und-Paul-Klosters nach Teinach abtransportieren, um dort damit den neu geschaffenen Badeort zu verschönern. (Schwarzwälder Bote, 16. 4. 2016)
Weitere Informationen
Die Prophetenfenster im Augsburger Dom
Hier geht es wohlgemerkt nicht um Fenster des Hirsauer Klosters, sondern der Augsburger Bischofskirche. Kunsthistoriker ordnen diese Glasmalereien dem Hirsauer Kunstkreis zu. Die auch Prophetenfenster genannte Serie, die zu den ältesten erhaltenen Glasfenstern überhaupt gehört, hat stilistisch eine große Ähnlichkeit mit Motiven der Hirsauer Buchmalerei, wie den Illustrationen im Stuttgarter Passionale – insbesondere im Pars Aestivalis – wie auch mit dem Bildnis Abt Wilhelms im Reichenbacher Schenkungsbuch. Sie stammen wahrscheinlich aus dem Anfang des 12. Jahrhunderts. Zu jener Zeit war St. Ulrich und Afra ein bedeutendes Kloster der Hirsauer Reformbewegung in Augsburg. Ob die hochmittelalterlichen Kirchen in Hirsau vergleichbare Glasfenster hatten ist nicht bekannt. Es gibt weder Grabungsfunde noch schriftliche Quellen, die hierzu Hinweise liefern.
Weitere Informationen
Kontakt
Freunde Kloster Hirsau e.V. Geschäftsstelle
Ortsverwaltung Hirsau/Rathaus
Aureliusplatz 10
75365 Calw-Hirsau
Telefon: 07051-9675-0